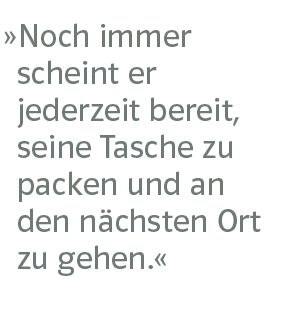23.06.2006 Baunetz
Porträt Stefan Wewerka, Reihe Grenzgänger No. 6/06
Unabhängigkeit bewahren.
»Es ist nicht zu fassen: Er ist nicht zu fassen« begann vor zwanzig Jahren ein Porträt über Stefan Wewerka im FAZ-Magazin. Dort wird er als stets Flüchtiger beschrieben, der in der Eisenbahn seine Heimstatt findet, sich hinter Grimassen, Verrenkungen und starken Worten verbirgt. Mitte der 80er Jahre standen seine Möbel und Kleidungsstücke im Mittelpunkt internationaler Wahrnehmung, strahlte der nach ihm benannte Pavillon auf der documenta VIII. Inzwischen ist es ruhiger geworden um den bald 78-Jährigen, nur er selbst wirkt immer noch ungestüm wie ein kleiner Junge.
Nach wie vor betrachten seine flinken, wachen Augen die Umwelt, strömt das Gesehene in die Gehirnwindungen und echot als manch scharfer Kommentar. »Alles Quatsch«, sagt er, wenn etwa die Rede auf die Mitte Berlins kommt, und ihm entfährt: »Die ganze Friedrichstraße, der Pariser Platz, so eine miese Provinzkacke – so etwas dahin zu stellen! Wirklich schlimm!«
In unzähligen Arbeitsfeldern war Wewerka in den vergangenen sechzig Jahren tätig: als Performer, Möbeldesigner, Bildhauer, Grafiker, Modeschöpfer, Dichter, Schauspieler. Studiert hat er freilich Architektur, von 1946 bis 1951 an der Hochschule der Künste in Berlin. Schon damals unorthodoxen Entschlüssen vertrauend, verzichtete er auf den akademischen Abschluss. »Ich habe aufgehört. Mein Lehrer Max Taut sagte mir: ›Gratuliere! Das war das Richtigste, was wollen Sie denn mit einem Diplom? Sie wissen, wie es geht.‹«
Wir sitzen vor Wewerkas Stammlokal »Stella di Mare« in der Berliner Uhlandstraße, wo er seit über vierzig Jahren wohnt. Er raucht zügig Zigaretten, schäkert mit der Wirtin, erzählt von seinem Stand für die dänische Firma Montana auf der letzten Möbelmesse in Kopenhagen, den er in Tokio noch einmal realisieren will. Er nimmt jeden wahr, der vorübergeht: Die russische Gattin des Nachbarn, den Galeristen, der sich spontan zu uns setzt. Zwischendurch stellt Frau Wewerka – »eine echte Kölsche« – ihre Einkäufe ab und entschwindet wieder. Es macht den Eindruck, er sei hier aufgewachsen, so alltäglich wirken die Gesten und Blicke, die er mit den Passanten austauscht. Tatsächlich aber ist Wewerka in seinem Leben meist anderwärts gewesen, und noch immer scheint er jederzeit bereit, seine Tasche zu packen und an den nächsten Ort zu gehen, dessen Eigenarten zu erkunden, den Dialekt anzunehmen – sein großes Talent –, sich eine Wohnung zu suchen – und kurz bevor er einer von den Einheimischen zu werden droht, wieder zu gehen.
Unruhe in eine Initiative umzumünzen lag Stefan Wewerka schon früh. Bereits im zweiten Studienjahr an der Akademie startete er mit seinem Kommilitonen Werner Rausch das erste Projekt: Studentenwohnungen. Eigenhändig bauten sie zwei teilzerstörte Schulgebäude auf dem Gelände des heutigen Berliner Studentendorfes Eichkamp aus. »Die Mauern standen, die Substanz war okay«, erläutert Wewerka. Aus ›Stoltedielen‹, das waren Betonelemente, zogen sie Decken in die hohen Klassenräume ein, errichteten Schrankwände aus billigen Holzplatten, bauten Garderoben und Waschbecken ein, montierten eine Arbeitsplatte am Fenster und eine Leiter hoch zur Schlafkoje. Die Hocker hatten sie aus der Schule geklaut. „Wir haben 28 Wohnungen gebaut. Das war toll.«
Unter den ersten Gästen waren zwei Architekten »mit Baskenmützen«, Hans Scharoun und Hugo Häring. »Die haben sich auf die Schenkel gehauen vor Vergnügen«, erinnert sich Wewerka nicht ohne Stolz an die Begegnung mit den berühmten Kollegen und gibt den Kommentar Scharouns mit bremischem Zungenschlag wieder: »Kleiner, das ist ja irre, was ihr da aus Dachlatten und Hartfaserplatten zusammengebaut habt.« Mit der Gründung des Studentendorfes wurde er im Kreis der Kollegen bekannt. Zwei Jahre später – er arbeitete im Büro der Brüder Luckhardt – gewann er den Wettbewerb für die Jugendherberge Venusberg in Bonn, deren Realisierung ihn in den nächsten Zeit oft ins Rheinland führte.
Der Gefallen am rheinischen Temperament ließ Wewerka 1954 nach Köln ziehen. Auf der Suche nach Arbeit klopfte er am Büro von Wilhelm Riphahn an. »Wo kommst du denn her, meine Junge?« Wewerka reflektiert die Konversation in breitem Kölsch: »›Aus Berlin.‹ ›Ah, aus Berlin. Wie geht es denn dem Scharoun?‹« Riphahn habe ihm dann das Modell vom Opernhaus gezeigt. »Frech wie ich war, sagte ich ›Herr Professor Riphahn, das wollen Sie doch so nicht bauen. Das ist Ägypten in Köln, das passt nicht.‹ Wortwörtlich! Seine Frau trat dazu und sagte zu ihrem Mann: ›Hast du gehört, was der Junge gesagt hat? Ich glaube, der hat Recht.‹«
Statt zu einer Vaterfigur, die Riphahn damals für viele junge Architekten war, verschlug es Wewerka in das Büro des nur wenig älteren Rudolf Schilling. Er entwarf dort zwei Wohnhäuser für die Kölner Innenstadt, half gemeinsam mit Ludwig Leo zwischenzeitlich dem Kollegen Oswald Mathias Ungers bei einem Wettbewerb. »Wir waren immer hungrig«, erinnert er sich.
Ihm ging es nicht darum, im Glanz berühmter Architekten zu strahlen und sich gar deren Autorität fügen zu müssen. Im Gegenteil: In seiner persönlichen Findung von Architektur nahm er seit 1953 an den Konferenzen der CIAM teil, der Vereinigung der Altvorderen moderner Architektur unter der Ägide von Le Corbusier. Gemeinsam mit jungen Kollegen aus anderen Ländern – sie bildeten in der Folge das »Team X« – hinterfragte er kritisch die Grundsätze der Väter. »Ein Student, der die Schule verlassen will,« schrieb er später, »sollte eher ein Mensch mit einer Vorstellung sein, eher ein Suchender als jemand, der sich seiner Sache sicher ist.«
Wewerka legte der Suche keinerlei Beschränkungen auf. In den folgenden Jahren entfernte er sich von der Praxis im Architekturbüro und widmete sich in Zeichnungen und Modellen den »Erdarchitekturen«, wie er die aus der Topographie entwickelten Gebilde nannte. Sie standen im Mittelpunkt seiner ersten Ausstellung 1958 in Wien und wirken wie eine visionäre Flucht in Richtung Mittelpunkt des Erdballs. Gleichzeitig skizzierte er aber auch megalomane oberirdische Strukturen – und malte. »Die Kunst«, erklärt er, der Sohn des Bildhauers Rudolf Wewerka, »ist ja meine Herkunft. Diese Sachen mache ich ohne nachzudenken.«
Seine Entwürfe und künstlerischen Arbeiten veschränkten sich zunehmend, auch die Orte: Köln, Berlin, Wien, nur das knappe Geld vermehrte sich nicht. 1961 zog er mit seiner Frau nach Paris und arbeitete ein Jahr lang im Büro von Georges Candilis und Shadrach Woods, die er vom Team X kannte. Der damalige Senatsbaudirektor Werner Düttmann war es, der ihn von dort zurück nach Berlin lockte. »Mensch, Wewerka«, ahmt Wewerka den Tonfall des charismatischen Kollegen nach, »komm nach Berlin, ich brauche jeden Mann.« Wewerka brach die Zelte in der französischen Hauptstadt ab und kehrte nach Berlin zurück. Heute bedauert er, ohne Rückfahrkarte gefahren zu sein. »Denn da lief erst einmal nichts, und meiner Familie und mir ging es ganz dreckig.« In Berlin wartete niemand auf ihn, vielmehr stichelten die Kollegen: »Der hat noch nichts gebaut.«
Möglicherweise wäre Wewerkas weiteres Leben, das er vor dem »Stella di Mare« in Berlin-Wilmersdorf so unterhaltsam Revue passieren lässt, in eine andere Richtung gegangen, hätte es ihn nicht an einem Winterabend in den Rohbau der Philharmonie getrieben. Während er in Dämmerlicht und Schneetreiben die rohe Betonstruktur durchmaß, schepperte nämlich ein Volkswagen vorbei, hielt an und ein Mann mit Baskenmütze stieg aus. »Scharoun! Das war der rettende Engel! Ich bin am nächsten Morgen in sein Atelier hingefahren und gleich dageblieben.«
Gut drei Jahre arbeitete er bei Scharoun im Charlottenburger Entwurfsbüro, »eine Art Vater-Sohn-Verhältnis«, obwohl oder vielleicht gerade weil ihre Auffassungen von Architektur sich deutlich unterschieden. Scharoun gewährte Wewerka genügend Freiraum. Er beteiligte sich an Wettbewerben, analysierte für den Senat den Berliner Siedlungsbau, entwarf die Reinickendorfer Siedlung »Frühauf«: strikte, parallele Zeilen, zwischen denen er geschickt die notwendige städtische Infrastruktur und öffentliche Räume platziert.
Wewerka war fast 37 Jahre alt, als er auf Vermittlung von Woods an die Washington University in St. Louis eingeladen wurde. Er, der die akademischen Weihen verschmäht hatte, lehrte nun als Gastprofessor Architektur. Nach einem Jahr, erzählt er, bot die Universität ihm einen Zehnjahresvertrag an. »Ich dachte an meine Projekte in Berlin und zögerte.« Heute würde Wewerka das Angebot annehmen. »Wir hätten dreizehnhundert Dollar jeden Monat gehabt. Das war ein Haufen Geld!« Zum Abschied formulierte Wewerka seine Position in einem an die Studenten gerichteten Brief: »Eine Architekturschule kann keine Formenfabrik sein, es muss ein Platz sein, wo Menschen um die Wahrheitsfindung kämpfen. Die Wahrheit erlaubt keine Kompromisse, sie fordert Unabhängigkeit.«
Seine persönliche Eigenständigkeit bewahrte sich Wewerka durch den unbekümmerten Wechsel zwischen Architektur und Kunst. Zurück aus den USA, entwarf er Wohnsiedlungen für Wettbewerbe und widmete sich erneut Stuhlskulpturen, mit denen er bereits 1961 begonnen hatte. »Ich habe langweilige Stühle zertrümmert und die Einzelteile zu Neuen zusammengesetzt,« er lacht, »aber sie waren falsch, nämlich nicht besitzbar.«
Wie die Stühle bringen auch seine Zeichnungen die Sehgewohnheiten in eine Schräglage. Mit dem verschobenen Relief einer Ledoux-Fassade, einer verzerrten Ladenfront oder tanzend erscheinenden Möbeln bringt Wewerka, der Künstler, das Gewohnte aus dem Gleichgewicht und verschafft sich eine eigene Sphäre.
Die Dinge eigensinnig zu betreiben, damit musste er im Alltag anecken. Sein letzter Job als Architekt war in Aachen, wo er als Gastdozent tätig war. »Auf der Präsentation einer geplanten Erweiterung der TH Aachen sagte ein Ministerialdirigent von der Regierung«, hier verfällt Wewerka in den Düsseldorfer Zungenschlag, »da kann ich gar nichts mit anfangen, was Sie da verzettelt haben.« Wewerka erbot sich als rettender Berater, wurde engagiert und arbeitete für ein Jahr innerhalb eines Planungsteams an dem Entwurf. »Doch der Büroleiter meinte irgendwann: ›Sie kommen immer zu spät.‹ Und: ›Sie bleiben auch schon mal drei Tage weg.‹ ›Wissen Sie‹, habe ich geantwortet, ›ich muss auch noch was für mich machen.‹ Doch der begriff gar nichts.«
Inzwischen hatten Wewerkas Bilder und Skulpturen Furore gemacht. Einzelausstellungen in Düsseldorf, München und anderswo verengten seine architektonische Ader, ja er wurde sogar zum Professor an die Fachhochschule für Kunst und Design in Köln berufen – für Malerei. Zunehmend ist dem Zuhörer im Restaurant schwindlig vor erzählter Lebensfülle geworden. Einen Halt im Erzählstrang bieten allein die charakteristischen Fähigkeiten von Wewerka: Das Beobachten, das Aneignen und das Provozieren.
Genau diese Talente nutzte er auch, als er Mitte der siebziger Jahre begann, bei dem Möbelhersteller TECTA Entwürfe für nutzbare Stücke umzusetzen. Manche erblicken in seinem M1 einen »demokratischen Tisch«, andere reine Kunst, Wewerka hingegen meint »Zu mir sagen die Leute: Dein M 1 ist eine Skulptur. Dabei ist das ein ganz normaler Tisch, der nur anders aussieht, der eine andere Gruppierung vorgibt.«
Mit dem Tisch und dem Stuhl B 1 gelang ihm der Durchbruch als Möbeldesigner. Gerade oder zu den Seiten gewandt, auf eine Armlehre aufgestützt oder an das breite Rückenteil angelehnt, der Stuhl regt zu vielfältigen Sitzpositionen an. Und setzt sich – wie sein Schöpfer – elegant über Normen hinweg, etwa die, dass Dreibeiner nicht standsicher sind.
Wie nichtssagend sind hingegen die in der Gastronomie beliebten Plastikstühle, auf denen wir vor dem Lokal sitzen. Wewerka wollte in Fortschreibung der modernen Formgebung mit seinen Möbeln Maßstäbe setzen – auch in der Architektur, mit dem als Hommage an Mies van der Rohe entworfenen documenta-Pavillon, der heute in Münster am Aasee steht. Selbst in der Mode hinterließ er mit Kleidungsstücken Spuren – ein weiterer Bogen in seinem mäandrierenden Lebenslauf, den er nicht breiter ausführt. Denn die Gegenwart drängt – der Stand in Kopenhagen, seine Neukonzeption für Tokio sind kein Thema mehr, sondern die russische Nachbarin soll ihn bei einem baldigen Vortrag vor Russen unterstützen. Was er ihnen vortragen wird? Er holt tief Luft, doch dann lacht er nur und ist wieder der junge Architekt, der das Klare und Schöne bewundert und den vielen Kollegen, die sich für Stars halten, eine Schelmennase zeigt. Grenzen kennt Wewerka nicht. Sie wären auch nur hinderlich, um die Forderung der Moderne einzulösen, »die Kunst ins Leben zu überführen.«